

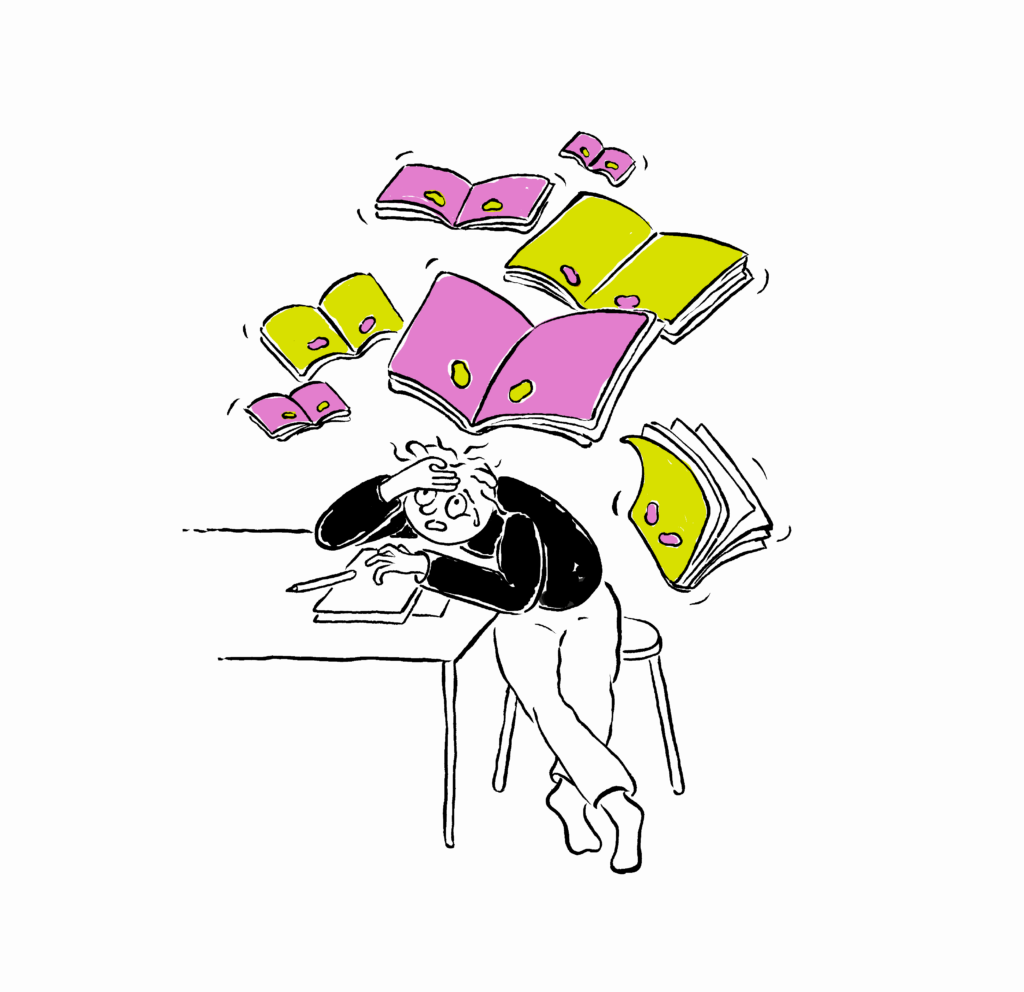
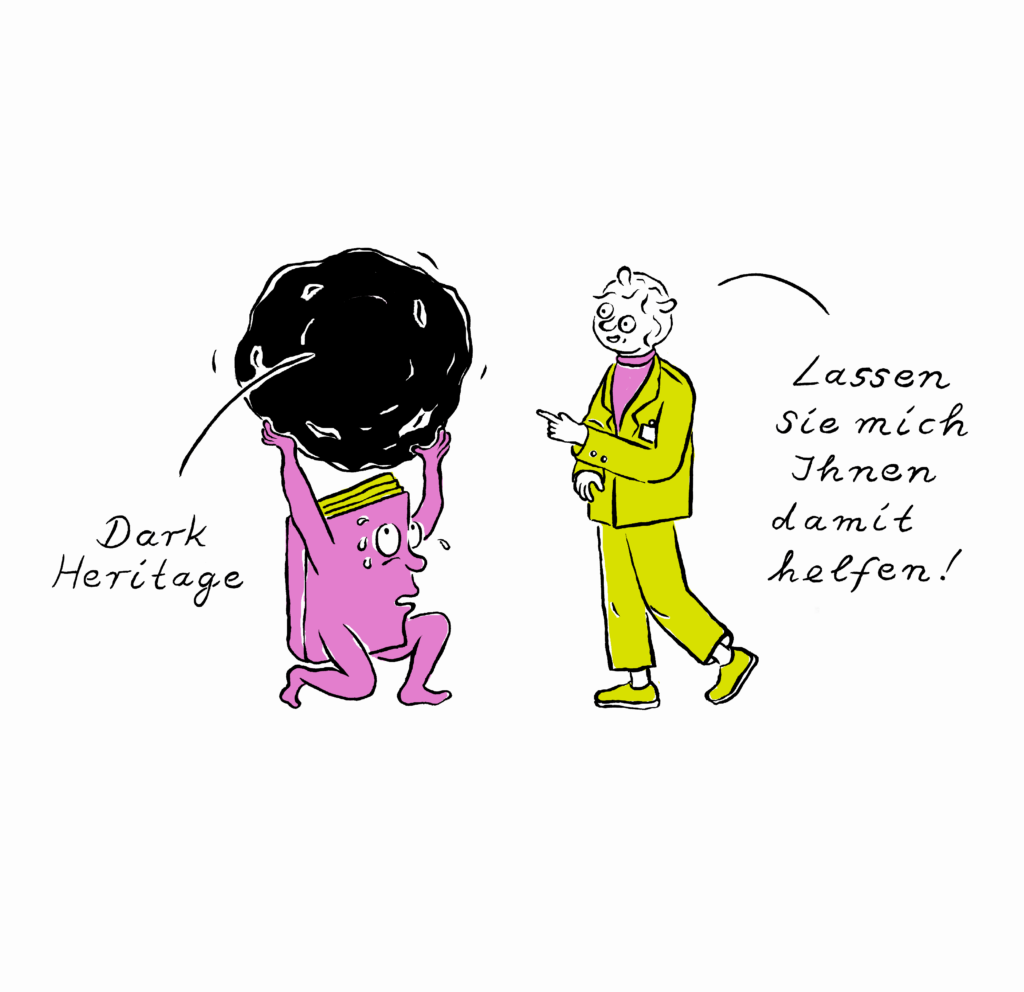
Illustrationen: Julia Boehme @studio_goof / Art Direktion: Studio Pandan
Einführung
Der Blick auf kulturelles Erbe kann auch unbequem sein: »Was wir Globalisierung nennen, verschafft den früher als peripher verstandenen Positionen Gehör, weckt aber auch ganz allgemein das Interesse an ihrer Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist der europäische Kolonialismus.« Der Historiker Jürgen Zimmerer bezeichnet den Postkolonialismus als zugehörig »zu den wirkmächtigsten Paradigmenwechseln«.[1]
Im Kolonialismus wurde zuhauf Kunst geraubt. So haben etwa auch Museen zur Popularisierung von geraubter Kunst beigetragen. Völkerkundemuseen entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Orte der Neugier auf »das Fremde« oder »Andere«, produzierten auf diese Weise jedoch auch verstärkt »Wir-Sie-Dichotomien« mit, eine Binarität von »Europa und der Rest der Welt«.
Im Nationalsozialismus wurden Werke plagiiert; die Namen von Verfasser*innen tauchen teilweise bis heute nicht wieder vollständig auf dem Werk auf. Auch hinsichtlich Objekten aus der Kolonialzeit gibt es viele Rückgabeforderungen und vehemente Debatten. So erklärt Jürgen Zimmerer: »Dieses schwierige Erbe kritisch mitzudenken und auch in den Ausstellungen zu reflektieren, muss ebenfalls Aufgabe der Museen sein. So können Museen von Agenten des Kolonialismus zu Agenten der Aufarbeitung des Kolonialismus werden.«[2] Zimmerer bezieht sich vor allem auf historische Museen, aber auch die literarische Welt, etwa Literaturmuseen, literarische Gesellschaften und Gedenkstätten sowie Literaturhäuser können Agent*innen der Aufarbeitung von Schwierigem Erbe werden und ihre Expertise diesbezüglich noch verstärkter weitergeben. Wo wird beispielhaft schwieriges Erbe in der Literatur behandelt? Welche Autor*innen sind relevant? Welche Literatur ist konkret schwieriges Erbe selbst? Werden Texte von Gottfried Benn, Ernst Jünger oder Georg van der Vring kritisch eingeordnet? Wird geraubte Literatur als solche ausreichend thematisiert? Warum müssen Texte von z. B. Karl May kontextualisiert werden?
[1] Jürgen Zimmerer: Kulturgut aus der Kolonialzeit – ein schwieriges Erbe? In: Museumskunde. Band 80. 2/15. Themenschwerpunkt: Die Biografie der Objekte. Provenienzforschung weiter denken. Deutscher Museumsbund 2015, S. 23.
[2] Ebd., S. 25.
Dark Heritage. Ein unbequemer Blick
von Ada Diagne
Mensch und Geschichte
Jeder, der sich mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt, wird unweigerlich erkennen, dass diese immer schon eine Geschichte des geistigen Aufwachens derselben war. Es scheint seit jeher das Schicksal von Menschen zu sein, sich in kontinuierlicher Weise mit der eigenen Position sowie mit fremden auseinanderzusetzen und sich ihrer bewusst zu werden. Immerzu stand bei dieser Aufklärung der Fortschritt im Mittelpunkt, sei es in wissenschaftlicher, technischer oder kultureller Hinsicht, sowie das Zusammenwachsen von Gesellschaften. Diese fortwährenden Veränderungen wurden immer schon von der Kunst begleitet, sei es durch Malerei, Theater, Musik oder Literatur. Man könnte fast sagen, die Menschheit bewege sich in sinusartiger Bewegung von einer kulturellen Veränderung zur nächsten, vergleichbar einem Pulsschlag. Auch mit Blick auf die derzeitige Debatte um Dekolonisierung lässt sich erkennen, dass die Menschheit wieder an einem derartigen kulturellen Wendepunkt angelangt ist und ein gesellschaftliches Aufwachen und Zusammenwachsen unmittelbar bevorsteht.
Fest steht jedenfalls, dass seit dem Tod des US-Amerikaners Georg Floyd durch übermäßige Polizeigewalt im Jahr 2020 die Debatte um die Rechte von Schwarzen Menschen[1] so präsent ist wie seit den Sechzigerjahren nicht mehr; seit dem »Afrikanischen Jahr«, in dem der Großteil der Staaten auf dem afrikanischen Kontinent unabhängig wurde. Es war die Zeit von Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba und Kwame Nkrumah – Persönlichkeiten, die im Westen fast unbekannt sind, für die afrikanische Unabhängigkeitsbewegung jedoch von elementarer Bedeutung waren. Menschen wie sie haben auf dem Kontinent erbittert für die Emanzipation von den Kolonialmächten gekämpft und teilweise dafür mit ihrem Leben bezahlt. Umso tragischer daher, dass ihre Namen im Westen dennoch kaum bekannt sind.
Nachdem die Zeit der Sklaverei und des Kolonialismus‘ zu Ende war, schien die Diskussion um die Rechte von Schwarzen Menschen zunächst einmal erloschen. Konnte man dies als Zeichen dafür deuten, dass mit Erlangung der Unabhängigkeit Gewalt, Macht und Unterdrückung gegen Menschen mit afrikanischem Erbe kein Thema mehr sind und diese allen anderen gesellschaftlichen Gruppen gleichgestellt? Schön wäre es und einfach obendrein. Tatsächlich aber sind die sozialen, ökonomischen und folglich auch ökologischen Konsequenzen, die die Zeit des Kolonialismus hinterlassen hat, zu tief und festsitzend, als dass sie durch eine rein formale Aufhebung im Rechtsweg beseitigt werden könnten – und schon gar nicht in so kurzer Zeit. Ein erneutes Zusammenwachsen der Gesellschaften wäre mehr als wünschenswert, doch scheint dieses Ziel noch weit entfernt, wie Georg Floyds Tod auf schmerzhafte Weise aufgezeigt hat.
Klar ist, dass erst alte Wunden heilen müssen, bevor ein neues Kapitel im Miteinander begonnen werden kann. Allerdings sitzt der Groll in der Schwarzen Gemeinschaft tief: Die Narben, die die Sklaverei hinterlassen hat, schmerzen nach wie vor, genauso wie die Ignoranz, die die weiße Elite diesem Thema entgegenbringt. Auch wenn ein Großteil aus der Schwarzen Community bereit ist, mit der weißen Dominanzgesellschaft eine neue Beziehung auf Augenhöhe einzugehen, frei von Frust, Missgunst oder Vergeltungsdrang, scheint auch dieses Unterfangen mit erheblichen Hürden belastet. Hier stellt sich etwa die Frage, wie mit einem ehemaligen Peiniger denn überhaupt eine gleichberechtigte Beziehung eingegangen werden kann, wenn dieser sich fortgesetzt weigert, den ehemals Unterdrückten nach ihrer physischen Befreiung auch ihr Gesicht und somit ihre Würde zurückzugeben. Die Bereitschaft zu vergeben ist da – aber nur auf Augenhöhe, von Angesicht zu Angesicht. Und um nicht weniger geht es bei dem Thema Dekolonisierung der Lebensbereiche. So etwa geht es bei den Rückgabeforderungen von kolonialen Raubgütern in Museen um nicht weniger als um die Rückerlangung des eigenen Gesichtes; oder geht es bei der Diskussion um die Darstellung Schwarzer Menschen in der Kunst um nicht weniger als um die Deutungshoheit über die eigene, schwarze Identität. Und so geht es auch bei der Frage, wie im Westen über den Globalen Süden berichtet werden soll, um nicht weniger als um ein Verhältnis auf Augenhöhe.
Museen, Kunst und Medien – all dies sind nur einige wenige Lebensbereiche, die von den jahrhundertealten Machtstrukturen des Kolonialismus durchzogen sind. Sie alle stellen einen dichten Machtteppich dar, dessen Fäden so eng sitzen, dass keine Menschenkraft und keine Worte ihn wieder auseinanderziehen können, so scheint es. Doch damit ein neues Kapitel im Miteinander möglich sein kann, ist es unerlässlich, dass dieser alte Machtteppich analysiert, aufgetrennt und neu wieder zusammengenäht wird, und zwar auf eine Weise, die alle Gesellschaften miteinschließt und ihnen einen gleichwertigen Platz bietet. In diesem Sinne beschäftigt sich das vorliegende Essay mit den vorherrschenden Machtstrukturen in westlichen Schulbüchern und mit der Frage, welche Konsequenzen diese auf Kinder haben können – haben diese nun eine schwarze oder eine weiße Haut.
Schule und Bücher
Die Schulzeit prägt Menschen in ihrer Identität – und das nicht bloß aufgrund der Freundschaften, die man in dieser Zeit knüpft. Neben den Beziehungen ist genauso das Wissen relevant, das man im Unterricht vermittelt bekommt, denn auch dieses formt das eigene Selbstbild. Es trägt dazu bei, den eigenen Platz in der Welt zu finden, zu erkennen, wo man steht, wer neben einem steht und in welche Richtung man gehen möchte. Neben kulturverbindenden Fächern wie Sprachen, die den Kindern helfen sollen, sich im Alltag der Gegenwart zurechtzufinden, lernen diese etwa im Geschichtsunterricht, wie sich Menschen vor ihnen in der Vergangenheit zurechtgefunden haben. So erfahren die Kinder zum Beispiel, was ihre Vorfahren in früheren Zeiten schon alles erlebt haben; wo sie Konflikte zu bewältigen hatten und wo Siegesgeschichten verbucht werden konnten. Oder sie erfahren, was diese an Erfindungen in die Welt gesetzt haben, die das Leben vieler Menschen verbesserten. Die westlichen Schulbücher sind voll von Vorbildern, die den Schüler*innen vorzeigen, was möglich ist, wenn man Intellekt und Stärke verbindet. Was alle diese Vorbilder jedenfalls gemein haben, ist, dass sie große Widerstände überwinden mussten, um am Ende ihr Ziel zu erreichen. Doch neben ihren Erfolgen für die Allgemeinheit haben fast alle diese Vorbilder noch etwas anderes gemein: und zwar ihre weiße Haut.
Es ist selbstverständlich, dass es Menschen und insbesondere Kinder mit Stolz erfüllt, wenn sie erfahren, dass die Geschichte ihrer Vorfahren, und somit auch ihre eigene Geschichte, Jahrtausende weit zurückreicht. Von der Steinzeit über das Römischen Reich bis hin zum Zeitalter der Aufklärung und der Industrialisierung: Die Geschichtsbücher sind voll von den Zeugnissen der Menschheit. Ob es sich nun um Konflikte und Friedensschlüsse handelt oder aber um bedeutsame Erfindungen – mensch geht natürlich ganz anders durch das Leben, wenn er im Hinterkopf das Bewusstsein mit sich trägt, dass er ein Nachfahre großer Held*innen und Macher*innen ist.
Dabei versteht es sich von selbst, dass Heldentum rein gar nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Vielmehr geht es darum, die innere Stärke zu entdecken und mit dieser sodann etwas Gutes für andere Menschen zu bewirken. Daher kann Heldentum auch gewiss nichts mit Kriterien wie Hautfarbe (oder anderen Merkmalen) zu tun haben. Umso lauter drängt sich demnach die Frage auf, wo dann all die Held*innen der Geschichte abgeblieben sind, die nicht die Hautfarbe weiß trugen, sondern schwarz.
Vielen ist gar nicht bewusst, dass der stolze Blick auf die eigene, lange, erfolgreiche Geschichte eben nicht allen Bevölkerungsgruppen gegeben ist, im Gegenteil. So lernen im Gegensatz zu weißen Schüler*innen Schwarze Schüler*innen vor allem eines: dass sie gar keine Geschichte hätten. Denn auch ihr Mutterkontinent Afrika hätte gar keine Geschichte. Wenn man die Diskussion um zugeschriebene oder tatsächliche Verbindungen von Schwarzen Schüler*innen zu Afrika einmal außen vorlässt, stellt sich dennoch die Frage, wie diese falsche Ansicht über den afrikanischen Kontinent überhaupt Eingang ins vorherrschende Weltbild finden konnte. Dies ist jedoch Thema einer ganz anderen Debatte, die eines ganz eigenen Essays bedürfte.
Wenn man nun einen Blick in die Schulbücher im Westen wirft, lässt sich schnell erkennen, wie in diesen über die Länder des Globalen Südens, zu denen auch die Länder in Afrika zählen, berichtet wird – und zwar nach jenem Grundprinzip, das Basis jeder Berichterstattung ist: Es gibt ein Subjekt, das über ein Objekt berichtet. In den westlichen Schulbüchern wird dem Globalen Norden die Position des Subjekts vorbehalten, während die Rolle des Objekts dem Globalen Süden zugedacht ist. Die Konsequenz daraus ist, dass Menschen mit Wurzeln im Globalen Süden eine ganz andere Perspektive auf sich, die eigenen Vorfahren und auch auf die Welt aufgedrängt bekommen: nämlich die eines Objekts. In diesem Sinne lernen auch Schwarze Schüler*innen erst einmal, dass das eigene Herkunftsland oder jenes eines Eltern- oder Großelternteils bloß das Anschauungsobjekt eines anderen Landes ist: Etwas, das man betrachtet, kategorisiert und (ein)ordnet. So lernen die Schüler*innen auch, dass das Land ihrer Vorfahren bloß eine »Kolonie« eines anderen Landes war, ohne jedoch zu wissen, was »Kolonie« überhaupt bedeutet. Vereinfacht gesagt kann man die Stellung einer Kolonie mit jener einer weißen Leinwand vergleichen: Ihr einziger Daseinszweck besteht darin, für andere bereitzustehen, damit diese sich mit Pinsel und Farbe auf ihr austoben können. Erst durch die Bemalung durch andere bekäme die weiße Leinwand einen Sinn und folglich eine Existenzberechtigung.
Nichts anderes geschah und geschieht mit den Ländern Afrikas. Es wird suggeriert, dass diese praktisch nicht existent waren, bevor der westliche Fuß erstmals seinen Abdruck auf dem Kontinent hinterlassen hat. Erst in diesem Moment scheinen die Länder wie aus dem Nichts entstanden zu sein. Dem westlichen Narrativ nach beginnt die afrikanische Geschichte somit erst dann, als der Europäer auf dem Kontinent ankam und begonnen hat, diesen zu »bemalen« bzw. zu »zivilisieren« – was in diesem Zusammenhang nichts anderes heißt als zu unterwerfen. Während andere Länder und Gesellschaften also höchst stolz auf ihre Jahrtausende alten Held*innen, Geschichten und Errungenschaften zurückblicken können, hätten Afrikaner*innen demnach sozusagen gerade erst das Licht der Welt erblickt. Dabei würde der Kontinent Afrika sogar noch gut wegkommen, bliebe es in westlichen Schulbüchern bei der bloßen Bezeichnung als ehemalige Kolonie. Tatsächlich aber wird im Zusammenhang mit den afrikanischen Ländern zusätzlich und hauptsächlich von Armut, Krankheiten und Kriminalität berichtet. Es ist nicht verwunderlich, dass daher auch Kinder mit sichtbar schwarzem Erbe mit diesen Attributen in Verbindung gebracht werden. Die Konsequenz von alledem ist im besten Fall Mitleid und Empathie, im schlimmsten Fall Generalverdacht und Gewalt. Wie viel Macht in dieser Darstellung »von oben herab« auf die afrikanischen Länder steckt, wird von den Verfasser*innen genannter Lektüren in der Regel nicht reflektiert.
Weißsein und Schwarzsein
Diese herabwürdigende Darstellung des afrikanischen Kontinents in westlichen Schulbüchern kann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Kinder haben, je nachdem ob diese Schwarz oder weiß sind. Kinder, die zufällig von dem niedergeschriebenen Machtungleichgewicht profitieren, weil sie weiß sind, können den Eindruck bekommen, dass die Welt um sie herum und alle Dinge, die in ihr existieren, Produkt der eigenen Überlegenheit bzw. der Überlegenheit der eigenen Vorfahren sind. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass sie sich selbst als tonangebendes Subjekt begreifen, dem das Recht zukommt, die Welt um sich herum zu deuten, mit dem Finger auf sie zu zeigen und sie zu definieren. In ihrem angelernten Weltbild stellen sie selbst die »Norm« dar, während die anderen (Menschen) im Schulbuch die Abweichung von der Norm seien. Als sogenannte Norm genießen sie demnach das Privileg eines unbeschriebenen Blattes: Sie selbst sind es, die ihre Identität aus allen ihnen zur Verfügung stehenden (Vor-)bildern zusammenschneidern und nach Maß anpassen können. Sie können sich selbst die hochwertigeren Attribute zuschreiben wie »schön«, »intelligent« oder »unschuldig«. Das Gegenteil trifft jedoch auf die »Anderen« im Schulbuch zu, denen die Stellung eines unbeschriebenen Blattes nicht zukommt. Im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent können Schwarze Kinder somit nur aus jenem Pool wählen, den Schulbücher und andere Medien ihnen anbieten. Dabei gibt es glücklicherweise neben den Attributen Armut, Krankheit und Kriminalität auch charmantere Zuschreibungen, derer sie sich bedienen können – wie etwa jene, dass alle Schwarzen Menschen außerordentlich gute Tänzer*innen und Sänger*innen wären. Unproblematisch ist es, solange Schwarze Menschen diesem Weltbild entsprechen. Dafür irritiert es umso mehr, wenn sie von diesem abweichen –, weil sie etwa wohlhabend statt arm, aufrichtig statt kriminell oder sprachgewandt statt tanzaffin sind. Hier wird das Weltbild der weißen Norm auf den Kopf gestellt.
Zur sogenannten weißen Norm zu gehören ist ein Privileg. Von den Privilegierten selbst bleibt dieses jedoch häufig unbemerkt, vielmehr nimmt der Großteil es als selbstverständlich an. Doch würde man den Privilegierten dieses Privileg, vor allem jenes des unbeschriebenen Blattes, abnehmen, so würde ihnen plötzlich bewusst, wie eng das Korsett der fremdbestimmten Andersartigkeit ist. Und wie kräftezehrend, sich von diesem wieder zu befreien.
Wie bereits erklärt, wird das Korsett, das den Nachfahren des afrikanischen Kontinents aufgezwungen wird, aus zwei verschiedenen Stoffen zusammengehalten: Entweder, dass man als Schwarze Person gar keine Geschichte habe, oder dass man bloß eine Geschichte der Herabwürdigung sein Eigen nennen könne. Diese zwei Varianten bieten die westlichen Schulbuchdarstellungen Schwarzen Menschen an. Durch das westliche Narrativ scheint der Platz für Schwarze Personen somit schon vorgegeben zu sein: in der Unterhaltungsindustrie oder im Drogenmilieu. Dass man als Schwarzer Mensch jedoch auch Dichter*in, Ärzt*in, Rechtsanwält*in, Physiker*in oder Bundespräsident*in werden kann, erscheint einem Schwarzen Schulkind eher fern – hat es doch auch im Schulunterricht nichts von entsprechenden Persönlichkeiten gelesen und gelernt. Doch mangelt es weiterhin an Schwarzen Held*innen im Geschichtsunterricht, wird es auch weiterhin an Schwarzen Held*innen in der Gegenwart leiden.
Neue alte Held*innen
Herabwürdigende Darstellungen in westlichen Schulbüchern haben also ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen. Fraglich ist, wie realistisch eine Auf- und Überarbeitung der afrikanischen Geschichte in diesen Büchern ist. Zweifellos würde eine vollkommene Entkolonisierung der Geschichte[2] sowie aller Lebensbereiche dem Westen erst einmal tief unter den Rock schauen und mit viel Unmut verbunden sein. Für den Globalen Norden bedeutete sie zweifelsohne neben ökonomischen Folgen auch einen drohenden Gesichtsverlust: Immerhin hat dieser sich selbst stets als wohltätiger, gebildeter und fortschrittlicher Akteur definiert. Dekolonisierung hingegen würde bedeuten, zugeben zu müssen, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden und man bereit ist, für diese einzustehen. Das jedoch wäre für das eigene Selbstbild und das nördliche Narrativ der Heldengeschichte überaus schädlich. Aber auch für den Globalen Süden bedeutet Dekolonisierung erst einmal ein Zähnezusammenbeißen. Angesichts des großen erlittenen Leids, das Schwarze Menschen über Jahrhunderte hinweg erlitten haben, erscheint es als enormer Kraftakt, die Emotionen zu zügeln und Vergebung statt Vergeltung zu üben und Freundschaft statt Frust zu suchen. Dennoch würden sich ihre Anstrengungen für beide Seiten lohnen. Wichtig ist jedenfalls hervorzuheben, dass die Betroffenen es nicht nur selbst in der Hand haben, dass dekolonisiert wird, sondern auch, wie dekolonisiert wird. Schwarzen Menschen ist sehr wohl klar, dass nicht alle Menschen, die der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, ihre Unterdrückung auch gewollt oder nicht dagegen angekämpft hätten. Wenn also Geschichte dekolonisiert wird, dann kann dies sehr wohl auf eine Weise geschehen, in der alle Seiten ihre Würde zurückbekommen und auch behalten können. Ein erster Schritt wäre es jedenfalls, Schwarzen Schulbuchheld*innen zur Sichtbarkeit ihrer Geschichte zu verhelfen. Denn Menschen wie Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba oder Kwame Nkrumah sind sehr wohl Teil der Geschichte – auch der westlichen.
[1] Auf dem Gebiet des White Criticism wird »Schwarz« als Bezeichnung einer Person, die der Gruppe der BlPoc angehört, großgeschrieben, um aufzuzeigen, dass diese Kategorie eine konstruierte und keine natürliche ist. In diesem Zusammenhang ist »Schwarz« ein politischer Begriff. Die Großschreibung soll auf die sozioökonomische Stellung und den gemeinsamen Erfahrungshintergrund, die die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe mit sich bringen, aufmerksam machen. Das Adjektiv »weiß« hingegen wird bei der Bezeichnung von Personen, die der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, klein und kursiv geschrieben, um aufzuzeigen, dass auch diese eine konstruierte und machtpolitische ist.
[2] Beispiele sind die Kontextualisierung in Geschichtsbüchern oder in der Beschriftung problematischer Denkmäler.
Die »Winnetou-
Debatte«,
die Karl-May-
Gesellschaft und die Frage der
»Kulturellen Aneignung«
von Laura Thüring
Wie die Fetzen [von Winnetous] Testament[] in die Luft gestreut, so halt- und ruhelos und fetzenhaft irrt und schwebt der rote Mann über die weiten Flächen, die einst ihm gehörten. / Aber wer zwischen den Gros-Ventre-Bergen am Metsurflusse vor dem Grabmale des Apachen steht, der sagt: ›Hier liegt Winnetou begraben, ein roter, aber großer Mann!‹ Und wenn einst der letzte dieser Fetzen zwischen Busch und Wasser vermodert ist, dann wird eine rechtlich denkende und fühlende Generation vor den Savannen und Bergen des Westens stehen und sagen: ›Hier ruht die rote Rasse; sie wurde nicht groß, weil sie nicht groß werden durfte!‹[1] (Karl May, Winnetou III)
Mit diesen Zeilen beschließt Karl May (1842–1912) seine 1893 in Buchform erschienene Romantrilogie Winnetou der Rote Gentleman, einen Bestseller, der etliche Generationen deutscher Leser des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat. Dabei bekundeten zahlreiche der damaligen Leser das pädagogische Potenzial von Mays Erzählungen, da es zu Toleranz, Nächstenliebe und Völkerverständigung erziehe. Auch wird konstatiert, dass die Lektüre von Mays Texten zur vertieften Beschäftigung mit Orientalistik und Indianistik anregen würde, und die Karl-May-Museen in Hohenstein-Ernstthal[2] und Radebeul[3] legen noch immer Zeugnis davon ab, wie nachhaltig positiv das seit Rousseaus »edlem Wilden« beständig romantisierte Bild »des Indianers« im kulturellen Gedächtnis der Deutschen verankert ist. Doch »den Indianer«, wie ihn Mays Werk zeichnet, gibt es nicht und hat es nie gegeben. »Indianer« ist ein durch Christoph Columbus kolonial geprägter, zuletzt in die Kritik geratener Sammelbegriff, der die vielfältige indigene Bevölkerung Nordamerikas über einen Kamm schert und wie jeder Überbegriff auf Stereotypenbildung beruht. Wie in der Einleitung des ersten Winnetou-Bandes, so beklagen auch die hier zitierten Zeilen das Schicksal der »Indianer« Nordamerikas, transportieren aber zugleich das Narrativ einer Bevölkerung, die weniger weit entwickelt sei als der »zivilisierte« Europäer.
Die sog. Winnetou-Debatte, die sich im Sommer 2022 durch die deutsche Medienlandschaft zog, wurde entfacht, nachdem der Ravensburger Verlag sich dazu entschlossen hatte, das kurz vorher erschienene Kinderbuch Der junge Häuptling Winnetou und ein dazugehöriges Puzzlespiel wegen des Vorwurfs rassistischer Inhalte und kultureller Aneignung wieder aus dem Programm zu nehmen. Die Debatte, die schon bald nicht mehr jene freie May-Adaption, sondern den Autor May und sein Werk selbst betraf, bezog sich letztlich darauf, dass die Darstellung der indigenen Menschen Nordamerikas heutzutage insbesondere aufgrund der Romantisierung und etwaigen Verharmlosung der Kolonialverbrechen an der indigenen Bevölkerung Nordamerikas höchst problematisch sei. Es entwickelte sich eine generelle Diskussion darüber, ob es heutzutage noch angebracht sei, Karl May zu lesen und jugendlichen Lesern zu empfehlen. Betrachtet man die oben zitierte Textstelle, so mag die Aufregung verwundern, denn das Narrativ der sterbenden »roten Rasse« klagt genau jene Kolonialverbrechen an.
Andererseits wird anhand obiger Textstelle auch ersichtlich, auf welche Aspekte die Kritiker sich keinesfalls zu Unrecht beziehen: Bezeichnungen wie »der rote Mann« oder »die rote Rasse« sind Stereotypisierungen, die pauschalisieren und zudem ein Vokabular verwenden, das aufgrund seiner diskriminierenden Konnotationen nicht mehr angemessen ist. Und sicherlich ist es anmaßend, wenn aus imperialistischer Sicht beanstandet wird, die indigene Bevölkerung Nordamerikas habe es zu nichts gebracht. Dass das Bild, das Karl May hatte, nur zum Teil der Realität entsprach und im höchsten Maße durch die eurozentrische Weltanschauung der damaligen Kolonialmächte geprägt war, wird hier deutlich. Dass Mays Empörung hinsichtlich der Verbrechen an der Urbevölkerung Nordamerikas allerdings groß war, er also trotz vorhandenem strukturellem Rassismus in seinem Werk strikt Kolonialverbrechen verurteilte und ein für seine Zeit in vielerlei Hinsicht fortschrittliches Empathievermögen für unterdrückte Völker hatte, sicherlich auch.
Entsprechend muss bei aller Kritik, die weder neu ist noch allzu fundiert daherkommt, immer der Zeitpunkt mitbedacht werden, zu dem diese Texte entstanden sind: Rassistische Geschichtsinterpretationen wie H. S. Chamberlains Grundlagen des 19. Jahrhunderts (Erstauflage 1899), in denen die Rassenlehre pseudowissenschaftlich ausgearbeitet wurde, galten zu Mays Zeiten als Standardwerke. Ganz Europa betrieb Kolonialpolitik auf der Basis rassistischer Überzeugungen, und in deutschen Landen machte sich ein kaum zu bändigender Wunsch nach nationaler Einheit breit, für dessen Umsetzung Krieg als völlig legitimes Mittel galt.
Die Institutionen um Karl May befassen sich nicht erst seit jener Mediendebatte im Sommer 2022 mit der Thematik. Neben vereinzelten Forschungsbeiträgen fand beispielsweise 2007 ein Symposium zum Thema Karl May als Brückenbauer der Kulturen statt, bei dem u. a. über koloniales Gedankengut in Mays Orienterzählungen diskutiert wurde[4] sowie einige Jahre später ein Symposium zu Mays Werk Zwischen Völkerstereotyp und Pazifismus, dessen Beiträge 2013 im Band Karl Mays Friedenswege dokumentiert sind.[5] Einige Monate vor der Debatte hatte die Karl-May-Gesellschaft auf ihrer Homepage ein Statement publiziert, das sich unter dem Titel ›»Kann man heute noch ›Indianerbücher‹ lesen?«‹ für einen offenen Diskurs, eine kritische Auseinandersetzung mit historischen Texten, gleichzeitig aber gegen eine Zensur problematischer Begrifflichkeiten oder gar ganzer Texte aussprach.[6]
Noch im gleichen Monat veröffentlichte die Gesellschaft gemeinsam mit der Karl-May-Stiftung einen Offenen Brief, der darlegte, auf welcher Basis eine solche Debatte geführt werden sollte. Diese Grundsätze seien hier kurz zusammengefasst: So müsse es Aufgabe der Literatur- und Kulturwissenschaften sein, jene problematischen Stellen in Mays Werk und in Texten seiner Zeitgenossen aufzuarbeiten. Gleichermaßen müsse aber berücksichtigt werden, dass sich in Mays idealisierter Darstellung Winnetous vor allem eine Sympathie des Erzählers gegenüber den indigenen Völkern Nordamerikas ausdrücke, die sich auch auf andere unterdrückte Kulturen erstrecke. Insofern vermitteln Mays Erzählungen Toleranz und Weltoffenheit. Zudem verweist der Brief auf die Leistung des Autors, sich, obwohl ihm ein Studium aus finanziellen Gründen verwehrt blieb, autodidaktisch weiterzubilden, wodurch May sich bald von dem chauvinistischen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts absetzte und in seinem Spätwerk am Vorabend des Ersten Weltkriegs die Utopie einer nationen- und konfessionsübergreifenden Menschheitsverbrüderung zeichnete. Anstößigkeiten aufgrund der Darstellung der Winnetou-Figur sollten nicht durch Zensur, sondern im Gegenteil durch die bewusste Auseinandersetzung und den Dialog darüber aufgearbeitet werden. Darum gelte es gerade vor dem Hintergrund der Debatte, sich differenziert mit Mays Texten auseinanderzusetzen.[7]
Im Oktober 2022, inmitten jener Debatte, fand in München mit coronabedingter einjähriger Verspätung der 51. Kongress der Karl-May-Gesellschaft statt. Dort wurde erstmals die neu entworfene »Marah-Durimeh-Medaille« verliehen, eine Würdigung, die Personen oder Institutionen mit besonderen Verdiensten für das Werk Mays und dessen Werte auszeichnen soll. Die weniger bekannte, namensgebende Figur »Marah Durimeh« entwickelt sich in Mays Spätwerk zur Allegorie der friedenstiftenden Menschheitsseele und steht somit für all jene philanthropischen Überzeugungen und Ideale Mays wie den Aufruf zur Völkerverständigung, das Streben nach Weltfrieden und das Nächstenliebe-Gebot, das der Autor insbesondere in seinen späten Romanen Und Friede auf Erden! (1904), Ardistan und Dschinnistan (1909) und Winnetou IV (1910) nicht müde wird zu betonen.
Philip Stölzl, namhafter Film-, Theater und Opernregisseur und erster Preisträger dieser Medaille, war u. a. Regisseur des 2016 erschienenen Mehrteilers Winnetou – der Mythos lebt, der mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle des Old Shatterhand mit dem deutschen Fernsehpreis »Beste Musik« und »Beste Ausstattung« ausgezeichnet worden ist. Kurz vor dieser erneuten filmischen Umsetzung des May-Klassikers hatte Stölzl auch bei Jan Dvoraks Bühnenstück DER PHANTAST oder Leben und Streben des Dr. Karl May (Uraufführung 2017 in Dresden) Regie geführt. In seiner Dankesrede zur Verleihung äußerte er sich zur Debatte wie folgt:
»Natürlich hatte May wenig Ahnung von den wirklichen Verhältnissen der brutalen Siedlergesellschaft der USA […], von der furchtbaren Wahrheit über General Custers Massaker an den indigenen Stämmen. Natürlich ist Mays Idee vom Christentum als alleinigem Heilsbringer für die ›Eingeborenen‘ in heutiger Betrachtung kurios und kolonialistisch. […] Natürlich finden sich bei ihm überall zahlreiche Klischees aus dem Vorurteils-Arsenal der wilhelminischen Gesellschaft. Aber auf der Skala des Kolonialismus ist May doch weltenfern von jenem brutalen Eurozentrismus, den Bert Brecht in seinem ›Kanonensong‹ in der Dreigroschenoper auf den Punkt gebracht hat: ›Wenn es mal regnete / und es begegnete / Ihnen ′ne neue Rasse, / ′ne braune oder blasse / Dann machen sie vielleicht daraus ihr Beafsteak Tartar.‹ Der gewaltige Erfolg der May’schen Indianergeschichten […] bewirkte, dass die amerikanischen Ureinwohner nirgendwo auf der Welt so bewundert und verehrt wurden wie in Deutschland – und das bis heute.
Aber gerade dies ruft im Augenblick heftige Einwände hervor: Diese ›kulturelle Aneignung‹ beraube die scheinbar Verehrten ihres angestammten Besitzes, ihrer Identität, über die nur sie selbst verfügen dürften. Dieser Vorwurf gegen Karl Mays Erbe […] ist freilich nur ein Detail im großen Katalog der zeitgenössischen Wachsamkeit: Sie fordert, alle traditionellen Kulturmuster der europäischen Welt, von den Geschlechterrollen bis zu Symbolen, von den kulturellen Hierarchien bis zu den moralischen Codes, von den Ur-Erzählungen der Literatur bis zu den Ur-Bildern der Kunst, radikal zu untersuchen, notfalls auch in Frage zu stellen.«[8]
All dies kontrovers zu diskutieren, die Vergangenheit ernst zu nehmen und entsprechend historische Kunstwerke »in Klugheit und mit aller verfügbaren Bildung in ihren Kontext zu stellen“ anstelle der »Entsorgung in die Aschentonne der Geschichte“, wie Stölzl weiter forderte,[9] sollte noch ein weiteres Jahr Hauptbeschäftigungsgebiet der Karl-May-Gesellschaft und der Karl-May-Museen[10] bleiben.
Die Karl-May-Gesellschaft nahm diese Ausgangssituation zum Anlass für mehrere Initiativen:
Zunächst wurde auf dem Kongress 2022 in München eine Podiumsdiskussion zum Thema »Was darf ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts gesagt haben? Reflexionen zur »Winnetou-Debatte« veranstaltet. Verschiedene Vertreter der May-Szene führten die Diskussion mit kurzen Statements ein, die im Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 2023 nachzulesen sind.[11]
In einem weiteren Schritt wurde gemeinsam mit der Karl-May-Stiftung eine »Arbeitsgemeinschaft Karl May vermitteln« organisiert. Dafür kamen im Herbst 2022 im Karl-May-Museum in Radebeul Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Kultur zusammen, die sich in irgendeiner Weise mit May befassen (Gesellschaft, Stiftung, Verlag, Bühnen etc.). Zudem wurden Angehörige mehrerer indigener Stämme Nordamerikas (Navajo Nation und Curve Lake First Nation) sowie Vertreter*innen aus dem Bereich Bildungs- und Kulturarbeit eingeladen. Die dabei entstandene gemeinsame Stellungnahme lässt sich unter dem folgenden Link abrufen: https://www.karl-may-museum.de/wp-content/uploads/2023/06/AG-KM-vermitteln-Gemeinsame-Erklaerung.pdf
Schließlich veranstaltete die Karl-May-Gesellschaft gemeinsam mit der Universität Potsdam und der Karl-May-Stiftung vom 17.–19.03.2023 ein durch die ALG gefördertes Symposium mit dem Titel »›Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein…‹ Kulturelle Repräsentationen im Werk Karl Mays im Brennpunkt aktueller Diskurse.« Damit sollte dem kontroversen Diskurs über kulturelle Aneignung nun wissenschaftlich fundiert und interdisziplinär begegnet werden. Unter Einbindung internationaler Referent*innen wurde die Thematik aus verschiedenen Perspektiven der Kulturwissenschaften (Literaturwissenschaft, Kunstpädagogik, Kulturanthropologie, Musikwissenschaft), der Rezeptions- und Kulturgeschichtsforschung (Museologie, Bühnen) sowie insbesondere auch unter Beteiligung von VertreterInnen indigener Völker Nordamerikas beleuchtet. Höhepunkte der Veranstaltung waren die Live-Schaltung mit Shoshana Wasserman vom First Americans Museum in Oklahoma City (USA), der Einführungsvortrag des Pop-Theoretikers und Journalisten Jens Balzer zur Definition von ‚Kultureller Aneignung‘ sowie die auf MDR-Kultur übertragene Podiumsdiskussion mit dem Titel »Karl May vermitteln«, bei der Indigene Nordamerikas mit Literaturexpertinnen und Literaturexperten und Bühnenvertreter*innen über die Frage des Rassismus einerseits sowie einen angemessenen Umgang mit Mays Werk in Schule und Universität andererseits debattieren. Die sehr angeregte Diskussion lässt sich unter dem folgenden Link anhören: https://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/audiothek/werkstatt-podiumsdiskussion-wie-karl-may-vermitteln-100.html
Im Frühjahr dieses Jahres erscheint im kopaed-Verlag der dazugehörige Tagungsband mit dem Titel Wer hat Angst vor Winnetou? Karl May im Spannungsfeld postkolonialer Diskurse. Ein interdisziplinäres Symposium der Karl-May-Gesellschaft, der Karl May Stiftung und der Universität Potsdam. Unter dem folgenden Link sind das Titelblatt sowie das Inhaltsverzeichnis einsehbar: https://www.kopaed.de/kopaedshop/?pg=2_15&pid=1492

Zusammenfassend lassen sich aus den Ergebnissen der Initiativen die folgenden Thesen formulieren:
1. Kulturelle Aneignung liegt laut wissenschaftlichen Definitionen vor, wenn »Angehörige einer Dominanzkultur Elemente einer fremden Kultur in einer stereotypen Weise repräsentieren, die von Angehörigen dieser fremden Kultur als verletzend empfunden werden könnte.«[12] Dabei ist kulturelle Aneignung eine an sich immer schon vorhandene Erscheinungsform des Kulturaustauschs. Diese erhielt allerdings im Zuge der Debatte eine negative Konnotation. Nach Jens Balzer kommt ihr gleichsam eine ethische Dimension zu. Zwei Aspekte seien demnach grundlegend: Respekt vor der fremden Kultur, der sich durch den Verzicht auf herabwürdigende Praktiken äußert, sowie die Einsicht, dass Kultur immer etwas Dynamisches, sich stets Veränderndes ist. Eine zeitgemäße Rezeption Karl Mays auf Bühnen und in Museen verlangt entsprechend nach gründlicher Analyse und einem reflektierten Umgang mit den Stereotypen, die May geschaffen hat.[13]
2. Die Ersetzung des »Indianer«-Begriffs durch andere Formulierungen wie z. B. »Indigene Nordamerikas« ist nur begrenzt zielführend, da auch jeder andere Begriff letztlich pauschalisierend ist. Da »Indianer« zwar kolonial geprägt, jedoch im deutschen Sprachgebrauch keineswegs abwertend verstanden wird, muss er zwar kritisch reflektiert werden, er ist aber nicht mit dem rassistisch herabwürdigenden »N-Wort« gleichzusetzen.[14]
3. Winnetou ist keine realistische Darstellung eines Apachen, sondern eine deutsche Idealfigur. Erläuternd sei hier aus der Gemeinsamen Stellungnahme (Link siehe oben) angeführt: »Als Zeugnisse deutscher Identitätsstiftung illustrieren [Mays Erzählungen] eine bis heute nachwirkende Phase europäischer Mentalitätsgeschichte: Karl Mays Wilder Westen und Karl Mays Orient entspringen zwar einem genuinen Interesse für das Fremde, verdanken jedoch ihre literarische Ausformung den eigenen Bedürfnissen und Bestrebungen des Autors. Die Beschäftigung mit Projektionsfiguren wie dem Apachen Winnetou […] ist für europäische Leserinnen und Leser letztlich auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität.« Die Figur des Winnetou hat somit viele ihrer Facetten Mays Fantasie sowie früheren literarisch-stereotypen Indianerdarstellungen zu verdanken, aber keinesfalls der Realität. Somit enthält sie notwendigerweise koloniale Denkmuster, bleibt aber dennoch eine literarische Fiktion und erhebt als solche keinen Anspruch, den wirklichen Indigenen Nordamerikas – weder damals noch heute – zu gleichen.[15]
4. Damit einher geht die kritische Erkenntnis, dass bei der Generation, die hauptsächlich mit Social Media aufwächst und kaum noch liest, die wesentliche Kompetenz, zwischen Realität und Fiktion unterscheiden zu können, bedroht scheint. Während Generationen von Leser*innen sich auf der Grundlage regelmäßigen Umgangs mit Literatur wie selbstverständlich dessen bewusst waren, dass es sich bei Mays Romanfiguren – ähnlich wie bei Pippi Langstrumpf oder Robinson Crusoe – um Phantasiegestalten handelt, scheint diese Fähigkeit bei jüngeren Generationen zunehmend abhanden zu kommen, was eine spezifische Befindlichkeit im Umgang mit Literatur mit sich bringt.[16]
5. Zentral ist das Bekenntnis der Karl-May-Gesellschaft und ihrer Schwesterinstitutionen, als Mitgestalter der Rezeptionsgeschichte Karl Mays die Aufarbeitung kolonialer Unrechtsstrukturen zu unterstützen und sich im Zuge dessen ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu sein. Die häufig stattfindende Reduktion Mays auf die in seinen Texten produzierten Stereotype und problematischen Gehalte, wird der Komplexität seines Gesamtwerks nicht gerecht, da sich dies in seinem Werk – wie oben bereits angeführt – durchaus ambivalent gestaltet und er sich gleichzeitig für Schwächere und Unterdrückte einsetzt und Rassismus scharf kritisiert (vgl. gemeinsame Stellungnahme wie oben).
Schlussendlich gilt es festzuhalten, dass ein demokratischer Staat auf den Maximen einer offenen Gesellschaft beruht, die ein kritisch denkendes, urteilsfähiges Bürgertum voraussetzt. Kritisches Denken kann aber nur durch die Konfrontation mit problemhaltigen Medien befördert werden. Sowohl die Handlung von Mays Texten als auch die in seinem Werk verarbeiteten kulturübergreifenden Kontexte der damaligen Zeit und der weltanschauliche Gehalt sind besonders geeignet, Leser*innen des 21. Jahrhunderts für die historische Bedingtheit von ethnischen Stereotypen und Geschlechterrollen und deren dynamischen Wandel zu sensibilisieren. Gerade aufgrund der Ambivalenz zwischen zeittypischem, strukturellem Rassismus und pazifistischer Toleranz und Völkerverständigung predigender Gesinnung von Mays Texten, regt die Lektüre zu kritischen und reflektierten Diskussionen an.
[1] Karl May: Winnetou III. Band. Reiseerzählung von Karl May. Reprint der ersten Buchausgabe von 1893. [Freiburger Erstausgaben. Hrsg. von Roland Schmid] Bamberg: 1982, S. 627.
[2] Karl Mays Geburtshaus, vgl: https://karl-may-haus.de/
[3] Karl Mays ›Villa Shatterhand‹, vgl. https://www.karl-may-museum.de/de/
[4] Vgl. den Tagungsband: Wolfram Pyta (Hrsg.): Karl May: Brückenbauer zwischen den Kulturen, Berlin 2012.
[5] Vgl. Holger Kuße (Hrsg.): Karl Mays Friedenswege. Sein Werk zwischen Völkerstereotyp und Pazifismus. Bamberg 2013.
[6] Vgl. https://www.karl-may-gesellschaft.de/2022/05/03/oldcms-850/
[7] Vgl. https://www.petitionen.com/ist_winnetou_erledigt_ein_offener_brief_von_karl-may-gesellschaft_und_karl-may-stiftung
[8] JB KMG 2023, S. 305.
[9] Ebd.; S. 306.
[10] Vgl. zu den Museen beispielsweise die Sonderausstellung des Karl-May-Hauses ‚Winnetou – Evolution eines Helden‘ von März 2023 bis Februar 2024: https://hohenstein-ernstthal.de/de/info/veranstaltung/sonderausstellung-des-karl-may-hauses-winnetou-evolution-eines-helden/ sowie die Dauerausstellung des Radebeuler-Museums mit dem Titel: ‚Indianer Nordamerikas‘: https://www.karl-may-museum.de/de/museum/ausstellungen/indianer-nordamerikas/
[11] Siehe Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 2023. Husum 2023, S. 307-326. Nachfolgend abgekürzt als ‚JB KMG‘.
[12] Vgl. Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 2023. Husum 2023, S. 323.
[13] Vgl. dazu Brenne, JB KMG 2023, S. 320f. sowie den ausführlichen Beitrag Balzers zur ‚Ethik der Appropriation‘ in Karl May postkolonial (geplantes Erscheinungsdatum Frühjahr 2024).
[14] Vgl. Leipold, JB KMG 2023, S. 315-319; Informationen finden sich auch auf dem folgenden Informationsblatt des Karl-May-Museums: https://www.karl-may-museum.de/wp-content/uploads/2023/06/Darf-man-noch-Indianer-sagen.pdf
[15] Vgl. dazu beispielsweise auch Schleburg, JB KMG 2023, S. 308-310.
[16] Vgl. Beiträge Brenner, JB KMG 2023, S. 322-325 und Thüring, ebd., S. 311-314.
