

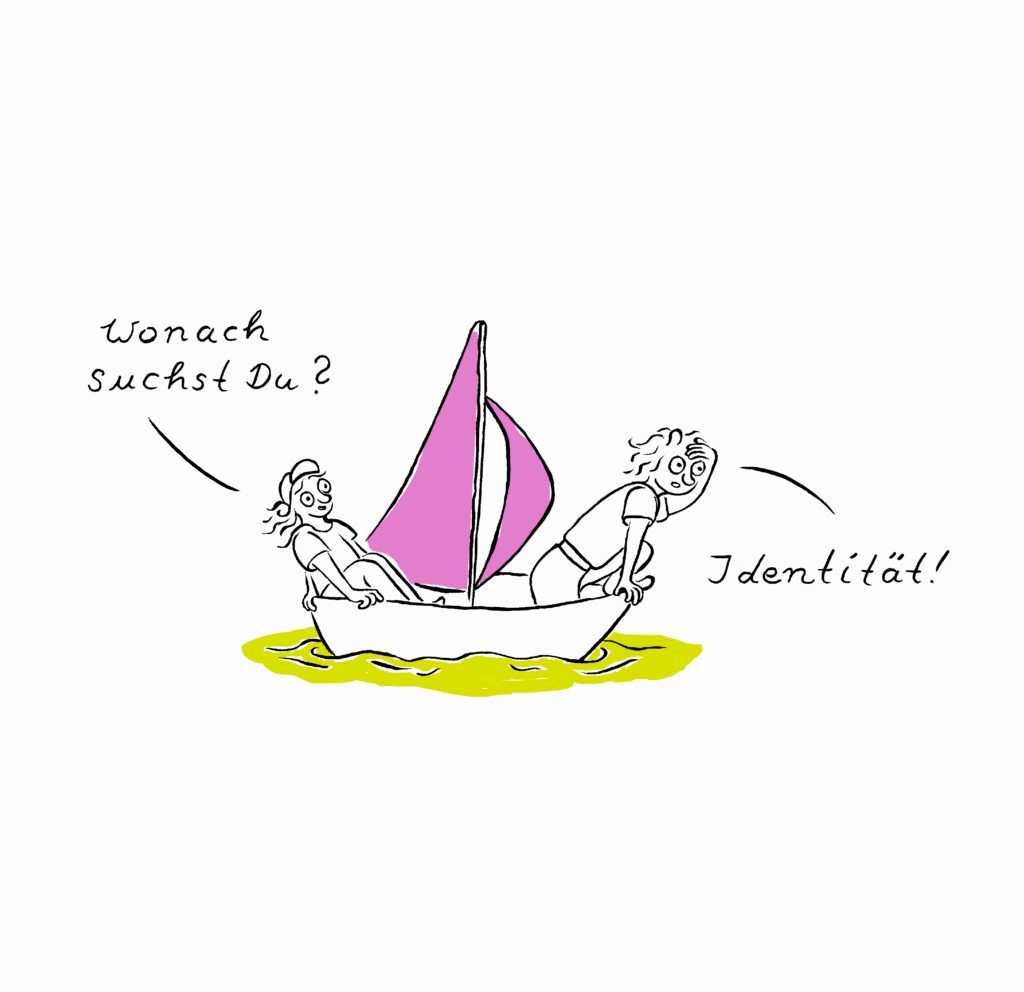

Illustrationen: Julia Boehme @studio_goof / Art Direktion: Studio Pandan
Einführung
»Identitäten sind eine Art Garantie dafür, daß die Welt doch nicht so rasch aus den Fugen gerät, wie es manchmal den Anschein hat. Sie sind so etwas wie ein Fixpunkt des Denkens und Seins, eine Grundlage für das Handeln, ein Ruhepol auf der sich drehenden Welt.«[1]
Identitäten können ein Ruhepol sein, oft haben sie aber auch keine stabile Bedeutung, sondern sind vielmehr prozesshaft, »eine Art nomadische Existenz«.[2]
Was aber ist kulturelle Identität? Ein Individuum fühlt sich zumeist einer Gemeinschaft zugehörig, beispielsweise einer sozialen Gruppe, einer Gesellschaft oder einer Subkultur. Ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht etwa durch gemeinsame Werte und Traditionen, eine gemeinsame Geschichte oder Sprache. Kulturelle Identitäten sind jedoch fluide und vielfältig.
Die Vielfalt kultureller Identitäten zeigt sich auch in der Literatur: Es entsteht etwa eine mehr und mehr von Mehrsprachigkeit geprägte Autor*innenschaft. Somit entsteht auch ein neues literarisches Erbe. Gleichzeitig gibt es regionale Sprachen, die aussterben, weil sie nicht mehr gesprochen oder gelesen werden und dann vergessen werden. Es gilt, Literatur und Sprache in ihrer Vielfältigkeit zu bewahren und zu vermitteln.
[1] Stuart Hall: Ethnizität: Identität und Differenz. In: Jan Engelmann (Hg.): Die kleinen Unterschiede. Der Cultural Studies- Reader, Campus 1999, S. 83.
[2] Vgl. Hall, S. 91.
Dichter ohne Sprache?
Paul Ernst (1866-1933) und Senthuran Varatharajah (*1984)
Sprachkrisen um 1900
Das Thema Sprachzweifel ist in den Jahren um 1900 auf vielfältige Weise präsent, am prominentesten sicher im berühmten »Chandos-Brief« von Hugo von Hofmannsthal. Dieser erschien am 18. und 19.10.1902 im sogenannten »roten Tag«, einer 1900 neugegründeten, durchaus ambitionierten Tageszeitung, zu deren frühen kritischen Mitarbeitern u.a. Männer wie Alfred Kerr oder Julius Hart gehörten, die ihre Pforten dann aber auch weit der Publizistik der Neuklassik und deren Fragestellungen und Diskussionen öffnete. Dass Ernst schon hier den »Chandos-Brief« las, ist daher nicht unwahrscheinlich. Man darf aber auch an die Sprachkrisen Stefan Georges denken, der erwogen hatte, nur noch auf Französisch zu dichten – oder gar in einer selbstgeschaffenen Sprache aus romanischen Sprachelementen, der »lingua romana« (die Niederschlag fand im Frühwerk »Die Fibel« und im »Schlussband« der Gesamtausgabe), ja, der sogar eine rein künstliche Sprache, »Imri«, geschaffen hatte, von der zwei Verse im Gedicht »Ursprünge« (in: »Der siebente Ring« 1907) überdauern. Andere Reaktionsformen auf das drohende Verstummen zeigen sich in einem Überhandnehmen der Satzzeichen, besonders der Gedankenstriche und Auslassungspunkte – auf die Spitze getrieben vom heute völlig vergessenen Ernst Schur (1876-1912), der in seinem ersten Gedichtband »Seht es sind Schmerzen an denen wir leiden« (1897) ein Gedicht nur aus figural angeordneten typographischen Zeichen bildet (m.E. die Anregung zu »Fisches Nachtgesang« von Christian Morgenstern!).
Ernst und die Suche nach der verlorenen Sprache
Die Hintergründe und Ursachen sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Autoren, es liegt darin gewiss auch eine Reaktion auf die verbrauchte Goldschnitt-, Butzenscheiben-, Festprolog- und Poesiealbendichtung des späten 19. Jahrhunderts, wie auch eine Aufnahme wissenschaftlicher und philosophischer Tendenzen, etwa der Wiederentdeckung des Stirnerschen Solipsismus oder der Forschungen von Ernst Mach.
Dass für Ernst diese Problematik von großer Bedeutung war, ist erst seit etwa der Jahrtausendwende verstärkt in den Blick genommen worden (besonders von Marco Bastianelli und vom Verfasser).
Als bei Ernst nach einer Phase politischer und journalistischer Arbeit für die SPD in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre wieder die Dichtung in den Vordergrund trat und er in dieser seine Berufung erkannte, da verband sich diese Erkenntnis mit einer zweiten, hochproblematischen: er sah sich als Dichter ohne Sprache: »Mir war wie einem Stummen, der viel mitzuteilen hat, und doch nur unverständliche Töne von sich geben kann. […] Das Leben war mir unerträglich dadurch, daß mir der Mund verschlossen war.«[1] Ernst glaubte, etwas ausdrücken zu müssen, fand aber kein ihm genügendes Ausdrucksmittel vor.
Hier spielen gewiss zeitgenössische literarische Entwicklungen eine Rolle, die Ernst im europäischen Rahmen aufmerksam verfolgte und auch kritisch begleitet hat, so z.B. die frühen Dramen von Maurice Maeterlinck, diese klaustrophobisch-intensiven Kammerspiele, deren Dialoge immer um ein Unausgesprochenes, vielleicht Unaussprechliches kreisen, das drohend in ihrem Mittelpunkt steht.
Ernsts Umgang mit dem Sprachzweifel
Bei Ernst differenziert sich die Problematik jedoch weiter aus in verschiedene Arten und Weisen des Umgangs mit ihr. Auf der einen Seite steht ein klassischer Sprachzweifel, der jedoch ganz wesentlich ein Kommunikationszweifel ist: denn wir sagen »stets nur den geringsten Teil von dem, was wir wirklich empfinden, und gerade das Wertvollste verschweigen wir. Je höher seelisch einer steht, desto mehr verschweigt er. Und endlich sind unsere Worte und Sätze Zeichen für Gefühle und Gedanken, die bei jedem verschieden sind.«[2] Diese Frage ist hier also zwischen Gesellschaft und Individuum anzusiedeln und zu verhandeln, eine individuelle Lösung bleibt denkbar – und wenn sie bis hin zu Georges Ansätzen zu einer eigenen Kunstsprache geht: »Erfand er für die dinge eigne namen«.[3]
Ernst ist das weniger fremd, als es scheint, jedoch verbleibt er im Rahmen unserer Sprache – im späteren »Erdachten Gespräch« »Das Land der Dichtung« zwischen Flaubert und Maupassant lässt er ersteren auf Maupassants Klage, es sei doch alles tausendmal gesagt, so antworten:
»Flaubert: ›Deshalb habe ich mich als junger Mensch vor ein Ding gesetzt, das schon tausendmal genannt war von älteren Dichtern, und habe es angesehen, und so lange habe ich es angesehen, bis ich das tausendunderste Wort für das Ding fand.‹
Maupassant (gedrückt): ›Nun, vielleicht hast du dann eben das letzte Wort für das Ding gefunden.‹
Flaubert: ›Es gibt kein letztes Wort, aber es gibt das tausendundzweite.‹ «[4]
Stille Motive und künstlerische Suche
Auf der anderen Seite finden sich in Ernsts Frühwerk ganz andere, allgemeine Stille-Motive, nicht selten in der Natur (fast obligatorisch klopft in der Ferne dann meist ein Specht), meist kündigt diese Stille etwas Bedrohliches an, besonders wo das Wort »lautlos« vorkommt (»und lautlos war es«). Dieser ganze Bereich ist daher am besten nicht mit Sprachlosigkeit, Stille, Schweigen zu bezeichnen, sondern mit Lautlosigkeit. Man könnte fast von einem Ausdruckszweifel sprechen, der hier schon im Vor- und Außersprachlichen liegt.
Ernst hat sich an diesen Fragen in allen Dichtungsgattungen abgearbeitet, in der Lyrik (»Polymeter« 1898, neu hrsg. mit Nachwort Leipzig: Reinecke & Voß 2016), in frühen Erzählungen (Taschenbuchauswahl »Der Mann mit dem tötenden Blick«, hrsg. von Wolfgang Promies, Frankfurt a.M.: Insel 1981) und auch in den ersten dramatischen Arbeiten (besonders »Wie die Blätter fallen – Der Tod. Zwei Einakter« Berlin u. Paris: Sassenbach 1899 u.a.). Diese Entwicklungen kommentieren z.T. seine Essays in der herausragenden Sammlung »Der Weg zur Form« (Berlin: Julius Bard 1906, kurz nach dem Druck übernommen vom Insel Verlag).
Ein Lösungsansatz schien sich ihm auf seiner ersten Italienreise 1900 zu bieten, als er die altitalienische Novellistik (er übersetzte »Altitaliänische Novellen« in 2 Bdn. für den jungen Insel-Verlag 1902) und einigen Bildern Giottos begegnete: »Das war die Welt, in die ich gehörte, diese Bilder, in welchen nicht ein Strich zu viel ist, alles etwas ausdrückt, etwas, das der Maler ausdrücken wollte. Ja, Giotto konnte sprechen, er schwatzte nicht. Alles ist notwendig in seinem Bild so, wie es ist. Das war es, das ich wollte, was ich nicht konnte.«[5]
Für die Novellen fasste es der Freund Franz Servaes in der ersten Gesamtwürdigung des Dichters Paul Ernst bereits 1904 so zusammen:
»Was diese Geschichten an sich bedeuten, braucht uns hier nicht zu kümmern. (Meiner Ansicht nach wurden sie von Ernst erheblich überschätzt.) Aber was sie für Paul Ernst bedeuteten, ist so einschneidend, dass wir ein wenig dabei verweilen müssen. Durch ihre Simplizität, durch ihr Gradausschreiten, durch ihre sittliche Unbeirrbarkeit und durch ihren kühl festgehaltenen künstlerischen Drüberstand setzten sie sich für den geistig Entwurzelten in einen überaus günstigen Gegensatz wider alle wahre und falsche Modernität, deren nervöses Flackern, unruhiges Sichspreizen und unstätes Experimentieren sie glatt auszulöschen schienen. Eine vollständig sichere Technik, die keine Ausdrucksmittel mehr zu suchen brauchte, und die darum alles, was sie sagen wollte, ruhig und bedenkenlos herausstellte, bezwang Ernstens unbefriedigtes künstlerisches Gemüt.«[6]
Erzählerisch war hiermit ein Boden gewonnen. Von der Lyrik hatte er sich auf lange Zeit so gut wie vollständig abgewandt, nicht zuletzt wohl auch, weil Publikum und Kritik den ungewohnten Ton der »Polymeter« überhaupt nicht angenommen hatten. Die Hauptarbeit galt nun auf längere Zeit der Form des als Königsdisziplin verstandenen Dramas, die es sich zu erringen galt. Die praktischen Bemühungen (eine größere Zahl an Dramen vernichtete Ernst, da sie ihm nicht genügten) begleitete reflektierend, vor- wie nachbereitend Ernsts essayistisches Werk, besonders die erwähnte, programmatische Sammlung »Der Weg zur Form. Ästhetische Abhandlungen vornehmlich zur Novelle und Tragödie« bündelt die entscheidenden Texte dieses theoretischen Begleitprozesses.
Überwindung des Sprachzweifels
Letztlich überwand Ernst den anfänglichen Sprachzweifel – zumindest zeit- und teilweise – mittels seiner Formästhetik: die dichterische Form – bei ihm immer primär als Gattungsform verstanden – schafft eine Ebene gestalterischer Objektivierung, die es ermöglichen kann, etwas Wesentliches mitzuteilen.
»Ich schrieb einfach mein Drama.«[7]
Ernst erklärte die Tragödie aus beiden Richtungen, rezeptionsästhetisch (aus dem Bedürfnis des Publikums, erschüttert zu werden) wie produktionsästhetisch (dem Dichter sei ein Mittel in die Hand gegeben, dem Publikum seine Inhalte aufzuzwingen, die an sich gegen dessen Instinkte gehen).
Daneben steht jedoch auch ein rezeptiver, sehr individueller Zugang, der aus der sprach- und kommunikationslosen Einsamkeit führen kann – und zwar durch teilnehmende Lektüre, die zugleich ein Sich-Einschreiben in eine Tradition bedeutet – hierzu aus dem »Erdachten Gespräch« »Ruhm« ein Hebbel in den Mund gelegtes, längeres Zitat – einfach, weil es so schön ist:
»Von Kind an bin ich einsam gewesen. Ich habe keinen Menschen gehabt, mit dem ich sprechen konnte; aber wie es dem Farbenblinden geht, der nichts von einem Mangel weiß: ich dachte, das müßte so sein. Da bekam ich das erstemal das Buch eines großen Dichters in die Hand und las, und wie ich las, da fühlte ich, daß ich nun einen Menschen hatte, mit dem ich sprechen konnte, und daß ich nicht so furchtbar einsam war in der Welt. Dann wurde mir klar: ich mußte mich selber zu dem bilden, der ich werden mußte, um würdig zu sein, mit den Großen zu sprechen. So habe ich gearbeitet, und jedes Jahr wurde ich meiner Gesellschaft würdiger. Ich weiß wohl: was ich gemacht, das hat jedes Einzelne seine Fehler, und es hat wohl Alles zusammen einen sehr großen Fehler: mir fehlt die Natur und die Freude – aber, hören Sie!, nicht weil mein Leben zu schwer gewesen ist, weil mich Armut und Niedrigkeit gedrückt haben und meine Zeit zu knapp bemessen war: sondern Natur und Freude fehlen in mir, weil ich nun so bin, daß sie mir fehlen; und daß ich so bin, das ist mein Fehler. Nur als ein Geringer darf ich in der Gesellschaft leben, in der Goethe und Shakespeare, Sophokles und Calderon leben: aber ich darf doch in ihr leben. Sie fragen mich immer nach dem Ruhm, und ich habe Ihnen immer gesagt, daß der Ruhm etwas Albernes ist, wie ein Titel oder ein Orden; aber jenseits dieses Albernen, daß einfältige Rezensenten mich loben oder tadeln, gedankenlose Menschen meine Werke lesen, und im besten Falle ein Jüngling durch mich begeistert wird, weil er mich mißversteht – jenseits dessen steht der Sinn des Ruhmes, und der ist: dieser Mensch hat die Gesellschaft gefunden, in die er gehört; er ist nicht mehr so einsam, wie er früher war, sondern er hat endlich nach lebenslanger Arbeit das Glück erlangt, das jedem Spießbürger ja angeboren ist: daß er nicht allein sein muß: in der Vergangenheit habe ich Gesellschaft, und in der Zukunft werde ich Gesellschaft haben.«[8]
Senthuran Varatharajah: Sprachlosigkeit als zentrales Motiv heute
Dass sich dieser Problemkomplex bei einem so bewussten – und auf seine Weise auch formbewussten! – Gegenwartsautor wie Senthuran Varatharajah wiederfand, erschien dem Berichterstatter wie ein Geschenk. Formulierungen wie, er empfände sich als »Dichter ohne Sprache« oder er antworte auf die Frage, wo er herkäme: »Ich komme aus der Sprachlosigkeit«, hätte auch Paul Ernst so sagen können.
Schaut man zu dieser Frage in die beiden Buchveröffentlichungen Varatharajahs, so wird man in der zweiten fündiger. Das Thema spielt auch im Debut »Vor der Zunahme der Zeichen« (Frankfurt a.M.: S. Fischer 2016) eine Rolle, scheint mir hier jedoch dem Themenkomplex Erinnerung/Vergessen nachgeordnet zu sein – und diese Erinnerung ist hier nicht primär als sprachliche gefasst, sie funktioniert hier stark bildlich-visuell. Das verschiebt sich in »Rot [Hunger]« (ebd. 2022) sehr auf die Seite des Sprachlichen. Virtuos ist hierbei der Umgang Varatharajahs mit Motiven, die er wie Versatzstücke immer wieder wiederholt und variiert. Auch diese Verfahrensweise verbindet ihn durchaus mit Paul Ernst, dessen Werk einzelne Motive wie eine Art Schimmelpilzgeflecht durchziehen. Sind dies bei Ernst in der Regel Bilder, so bei Varatharajah meist sprachliche Formeln. Einige Wendungen – z.B. »Du weißt es« – kommen bereits im Erstling vor, manche werden bis zu zehn oder fünfzehnmal wiederholt und bisweilen auch leicht variiert. Es lohnt sich unbedingt, »Rot [Hunger]« mehrfach zu lesen, um die vielen Motivverwendungen nachvollziehen zu können.
Kann man »Vor der Zunahme der Zeichen« noch als ein Fortschreiben der alten Tradition des Briefromans ins Facebook-Zeitalter lesen, so schafft sich Varatharajah mit »Rot [Hunger]« im Grunde eine eigene Prosaform – der Gattungsbegriff »Roman« erfasst dieses Buch formal nicht mehr und wurde auf Wunsch des Verlages hinzugefügt. Die Verschränkung der als Liebesgeschichte verstandenen Geschichte des sogenannten »Kannibalen von Rotenburg« mit autofiktionalen, fast tagebuchartigen Passagen nähert sich einer Form des Lang- und Prosagedichts. Varatharajah selbst äußerte, dies sei sein letzter Roman gewesen; in Arbeit befinde sich ein Gedichtband, in dem er Jahr für Jahr seit 1990 jeweils einem Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland eine Stimme zu geben versucht. Nach den vorliegenden Arbeiten, speziell eben auch der letzten, darf man in jeder Hinsicht auf dieses Werk gespannt sein.
Varatharajah und Ernst
Zuletzt: Autoren entwickeln sich. Senthuran Varatharajah sagte in einem neueren Interview, er würde sich heute ganz im Gegenteil, als ein Dichter NUR aus Sprache verstehen. Auch hier scheint ein Weg vollzogen, den schon Paul Ernst zu gehen genötigt war, auch hier ist die Brücke zu ihm leicht zu schlagen, der aus einem Dichter ohne Sprache gerade in der neuklassischen Dramatik auch zu einem Dichter nur aus Sprache wird, indem das äußere Geschehen minimiert und der Konflikt ganz über den sprachlichen Dialog vermittelt wird. Auf Bühnenzauber, Effekte etc. legte Ernst keinerlei Wert, der befreundete Wilhelm von Scholz gab in seinen Erinnerungen mit spürbarem Befremden wieder, wie ihm Ernst die ideale Aufführung seiner Dramen darstellte: »Es war kein Scherz, daß er einmal erklärte, seine ›Brunhild‹ würde er am liebsten so aufgeführt sehen, wie es bei musikalischen Oratorien üblich ist: daß die Darsteller im Gesellschaftsanzug in einer Reihe sitzen und jeweils sich der Sprechende erhebt, um ohne Spiel, lediglich mit gesteigertem seelischem Ausdruck, seine Verse zu bringen.«[9]
Mehr Dichtung nur aus Sprache, mehr Verzicht auf Außersprachliches scheint schwer denkbar.
Und wieder einmal ist Ernst weit moderner, als man gemeinhin meint und weiß – vielleicht sogar weit moderner, als er selbst wusste und wollte…
Ein Wagnis und ein Geschenk
Für die Paul-Ernst-Gesellschaft war die Veranstaltung einerseits ein Wagnis: als kleine, dezentrale Gesellschaft gibt es keinen Ort, an dem man für eine Einzelveranstaltung mehr als ein-zwei Mitglieder vor Ort erwarten dürfte; vor allem aber erwies sich andererseits die Begegnung der Autoren Paul Ernst und Senthuran Varatharajah als ein Geschenk – und es konnte in Leipzig auch tatsächlich Publikum erreicht werden (und Publikum!, Publikum! – das schien längst schon weit in das Reich des Mythisch-Märchenhaften entrückt, so wie pünktliche Züge oder funktionierende Post – ich war nicht sicher, so etwas noch mit eigenen Augen sehen zu dürfen…), und zwar eines, das vorwiegend nicht wegen Paul Ernst kam, insofern aber eben neu auf ihn aufmerksam werden konnte. Ob da etwas fortwirkt, das freilich wissen die Götter – aber es gilt, was Hans Erich Nossack am Schluss seiner Erzählung »Der Neugierige« schreibt: »Versuch es, zu rufen, damit es leiser in dir und die Stille um dich lauter wird! Ob auch keiner da ist, dich zu hören, es hilft dir. Und wer weiß, vielleicht ist doch einer da, und es hilft ihm.«
Insofern – wir machen weiter. Oft liest man in strafrechtlichen Zusammenhängen: Der »Versuch ist strafbar«. – Für uns gilt in diesem Fall: »Der Versuch ist nötig!« Und wer weiß – vielleicht sogar irgendwann einmal fruchtbar…
Dass er überhaupt möglich war, dafür gilt der herzliche Dank der ALG, durch deren Blog wir überhaupt erst auf Senthuran Varatharajah aufmerksam wurden – und ohne deren Fördermöglichkeiten eine solche Veranstaltung für uns nicht einmal denkbar gewesen wäre.
[1] Paul Ernst: Entwicklungen. Hrsg. von Karl August Kutzbach. München: Claudius 1966, S. 321f.
[2] Paul Ernst: Zwei Selbstanzeigen. In: Der Weg zur Form. Ästhetische Abhandlungen vornehmlich zur Tragödie und Novelle. Berlin: Julius Bard 1906, S. 37 [Erstdruck 1898 in Hardens »Zukunft«].
[3] »Des sehers wort ist wenigen gemeinsam« in: »Das jahr der seele« 1897.
[4] Paul Ernst: Erdachte Gespräche. München: Georg Müller 1931, S. 44f.
[5] Paul Ernst: Entwicklungen. Hrsg. von Karl August Kutzbach. München: Claudius 1966, S. 325.
[6] Franz Servaes: Paul Ernst. In: Das Literarische Echo, 6. Jg., Heft 15 (01.05.1904), Sp. 1045-1054, hier Sp. 1051.
[7] Paul Ernst: Entwicklungen. Hrsg. von Karl August Kutzbach. München: Claudius 1966, S. 300.
[8] Paul Ernst: Erdachte Gespräche. München: Georg Müller 1931, S. 15f.
[9] Wilhelm von Scholz: An Ilm und Isar. Lebenserinnerungen. Leipzig: Paul List 1939, S. 129.
In der entschlossenen Bereitschaft dieser Geste
von Senthuran Varatharajah
Wenn wir lesen, warten wir. Wenn wir lesen – warten wir weiter. Das: ist das erste Versprechen; der einsame Bund. Jede Hand beweist es: In unseren offenen, wie zu einem muslimischen Gebet geformten Händen, in der tiefen Absicht dieser einfachen Geste, die nicht zufällig an die Art erinnert, wie wir ein Geschenk aus Dankbarkeit entgegennehmen, liegt ein Buch; aufgeschlagen, und erschöpft, die zählbaren Trümmer eines Menschen, der durch die Finger der Stunden nachts zu uns kam, um uns bei unserem Namen zu rufen – ohne nach ihm gefragt zu haben. Die Sprache, die er spricht, kennen wir nicht. Sie ist uns fremd, nicht die Sprache unseres Mundes, aber sie wird die unserer Augen bald sein, und darum verständlich. In dieser Sprache gibt er sich zu erkennen. In dieser Sprache steht ein Mensch vor uns. In dieser Sprache steht er in unseren Händen von den Toten wieder auf. Ein Buch erscheint uns – und wir sprechen vom Erscheinen, vom Erscheinungstermin eines Buches, als wäre ein Buch ein Gespenst, auf das wir gewartet haben, und das sich in kleineren Zeichen bemerkbar macht, ein Gespenst, das sich selbst ankündigt –, wie aus dem Nichts; wie ein Mensch, nach zu langer Flucht; wie ein müder Odysseus, der, zehn Jahre zu spät, als Bettler unerkannt heimkehren konnte. Jeder Daumen beweist es: Sie liegen auf den Seiten, den glattgestrichenen, wie auf dem Teller, den wir einem Gast anbieten, vorsichtig, langsam, und bestimmt. Diese beiden Bewegungen begründen das Geheimnis des Lesens: das Entgegennehmen des Geschenkes, so, wie auch das Reichen des Abendessens. Sie zeigen in zwei verschiedene Richtungen, weil sie aus derselben Richtung kommen, und weil sie nur diese eine Richtung meinen. Das: ist das erste Versprechen; der erste Bund. Wenn wir lesen, strecken wir unsere Hände aus. Wenn wir lesen, warten wir. Wenn wir lesen – laden wir einen anderen zu uns ein. Paul Celan sagt, das Gedicht ist gestaltgewordene Sprache eines Einzelnen, und seinem innersten Wesen nach Gegenwart und Präsenz. Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs.
Wer es schrieb, bleibt ihm mitgegeben.
In den Zeitungen steht:
Flucht nach Europa. Mindestens 44 Geflüchtete vor der Küste der Westsahara ertrunken.
In den Zeitungen stand:
Mehr als 20 000 Tote auf Mittelmeer-Fluchtroute seit 2014.
Im Herzen einer Ästhetik des Lesens liegt eine Ethik des Lesens: eine Poetik und Hermeneutik der Gastfreundschaft. Das altgriechische xenos bedeutet nicht nur Fremder, Ausländer oder Reisender, sondern auch Gast. Das lateinische hostis bedeutet Fremder, Ausländer, Feind und Gast. Das französische hôte bedeutet beides: Gast und Gastgeber. Ein Akt der Gastfreundschaft, schreibt Jacques Derrida, kann nur poetisch sein. Diesen rätselhaften Satz müssen wir beim Wort nehmen. Auch, wenn Derridas Philosophie der Gastfreundschaft, die aus der Frage des Fremden heraus formuliert wurde, streng genommen keine ausdrückliche Theorie des Lesens ist, können wir ihr dennoch implizite und assoziative Hinweise entnehmen, die uns vom ersten Versprechen vielleicht zu einem zweiten führen. Das erste Versprechen ist das Versprechen der Geduld. Unsere zitternden Hände geben es: diesem Buch, das wir mit der Bereitschaft der Zeit, die seine Sätze brauchen werden, und mit dem Einverständnis unserer Zunge, die noch nicht zu sprechen gelernt hat, öffnen. Einen Menschen, der vor uns steht, weisen wir nicht ab. Mit dieser biblischen Verantwortung ist das erste Versprechen verwandt. Bereits vor dem ersten Wort – haben wir jedes Wort, das noch kommen könnte, angerufen; aufgerufen; in uns hineingerufen. Bereits vor dem ersten Satz – sprachen wir unsere Einladung aus. Durch die antinomische Polysemie der drei Wörter xenos, hostis und hôte hindurch unterscheidet Derrida zwei Formen der Gastfreundschaft, die aufeinander angewiesen sind: weil sie sich ausschließen und widersprechen. Die unbedingte Gastfreundschaft, schreibt Derrida, setzt einen Bruch mit der bedingten Gastfreundschaft, dem Recht auf Gastfreundschaft voraus. Mit anderen Worten: Die unbedingte Gastfreundschaft erfordert, daß ich mein Zuhause öffne, und nicht nur dem Fremden, sondern auch dem unbekannten, anonymen, absolut Anderen, daß ich ihn kommen lasse, ankommen, ohne eine Gegenseitigkeit zu verlangen. Das Gesetz der absoluten Gastfreundschaft gebietet, mit der rechtlich geregelten Gastfreundschaft zu brechen. Mit denselben Worten: Was wäre eine Gastfreundschaft, die nicht bereit wäre, dem Toten, dem Wiedergänger gewährt zu werden? Der Tote, der uns heimsucht und besucht, ist das Gespenst. In einigen Ländern ist der Fremde, den man empfängt, für einen Tag der Gott. Das Gesetz der unbedingten Gastfreundschaft ist heilig. Nur deshalb wählte Derrida zu seiner Veranschaulichung ein biblisches Beispiel, das er die große Gründungszene abrahamitischer Gastfreundschaft nennt: Als Gott während der Hitze dieses Tages Abraham in der Gestalt von drei Männern vor seinem Zelt im Hain Mamre erschienen war, nahm er die Fremden bei sich zu Hause auf und gab ihnen Wasser, Fleisch, Brot und Schatten. Diese Gäste – wurden Abrahams Gäste, nur aus einem Grund: weil sie hier vor ihm standen; weil sie gekommen waren, wie aus dem Nichts. Abraham kannte sie nicht. Abraham wusste nicht, dass diese drei Männer sein unerkannter, sein unerwarteter Gott waren. Er stellte keine Fragen. Er befolgte nur das Gesetz, das er begründen wird – indem er es exemplifizierte.
Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, und verneigte sich zur Erde.
In den Zeitungen steht:
90 Flüchtlinge vor der Küste Syriens ertrunken.
In den Zeitungen stand:
2019 bereits mehr als 1000 Tote im Mittelmeer.
Im Herzen einer Ästhetik des Lesens liegt eine Ethik des Lesens: eine Optik und Akustik des Empfangens: eine andere Lehre der Ausbreitung von Schall und Licht. Für Emmanuel Lévinas, den Derrida als heimlichen Kronzeugen immer wieder zitiert, ist das Wesen der Sprache Freundschaft und Gastlichkeit. Jedes Subjekt – sei ein Gastgeber. Ein Nachkomme Abrahams; die Wirklichkeit seines Gesetzes. Wenn wir lesen, nehmen wir einen Menschen auf; zu uns, und in uns: Wir gewähren seinem Sprach- und Textkörper, jedem vereinzelten Zeichen und Leerzeichen, den Interpunktionen und Atempausen, den Motiven und Kadenzen, die durch seine gekrümmten Finger kamen, Zuflucht und Asyl; der Erfahrung, von der das Buch erzählt, so, wie auch dem, was nie in den Händen dieses Menschen, der es geschrieben hat, lag: die Ungewissheit des Bezeichneten, der der verborgenere Wille der Buchstaben ist, das Drängen, der Sinn und Eigensinn der Wörter. Ein Mensch, der schreibt, bleibt der Sprache mitgegeben – weil er sich ihr hingegeben hat; weil er sich ihr gibt, gab, und geben wird, und sich in ihr auf-gibt. Das Gesetz der Hingabe ist, wie das Gesetz des Empfangens auch, heilig. Annie Ernaux wählte ein biblisches Beispiel, das Sakrament der Eucharistie, des Abendmahls, eines Bundes im Geist der Gastfreundschaft, und eine Paraphrase der Einsetzungsworte Christi, um dieses
tödliche Vorhaben, die Vorbedingungen meines Schreibens, zu formulieren: Nehmt, und lest, denn das ist mein Leib und mein Blut, das ich für euch vergießen werde. Das Buch ist uns gegeben worden. Dieser Körper, seine Adern, Sehnen und Knochen, seine Knorpel, Wimpern und faltbaren Muskeln aus Schwärze und Papier, der Rücken eines Buches, der nur der Rücken eines Menschen ist, wurden uns anvertraut, wurden uns geschenkt; an uns verteilt, wie eine Hostie. Wenn wir lesen, kehren wir ein Evangelium um: Das Wort, das Fleisch geworden war, wird wieder Wort; damit das Wort unser Fleisch werden kann. Wenn wir lesen, beweisen wir ein anderes: Die Toten werden wieder auferstehen. Das lateinische hostis ist die Wurzel von hostia – der Hostie. Der Fremde, der Ausländer, der Feind und Gast sind der etymologische Ursprung des heiligen Opfers, der Opfergabe: der Leib Christi, in unserem Mund. Christus verkörpert die Polysemie dieser drei Wörter: Er ist nicht nur hostis, sondern auch xenos, der Reisende, so, wie ein hôte: der Gastgeber des Abendmahls. Wir lesen ein Buch wie einen Körper. Die konsequenteste Einhaltung dieses abrahamitischen Gesetzes im Bezirk der Texte, des Lesens als hermeneutischer Wirklichkeit einer absoluten und unbedingten Gastfreundschaft, finden wir in der katholischen Mystik Simone Weils. Auch, wenn Weil streng genommen keine ausdrückliche Theorie des Lesens entwickelt, können wir ihrem phänomenologischen und epistemologischen Begriff der attention, der Aufmerksamkeit, dennoch explizite und assoziative Hinweise entnehmen, die uns dem zweiten Versprechen, vielleicht, näherbringen. Die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer, und für diesen Gegenstand offen zu halten. Der Geist soll leer sein, wartend, nichts suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen. Wenn wir lesen, geben unsere langsameren Hände unsere Einwilligung: Wir erlauben es diesem Buch, sich in uns einzufinden; sich in uns niederzulassen; sich in uns auszubreiten: seinem Schall, und vor allem seinem Schweigen; seinem Licht, und seiner hermetischen Nacht. Das könnte eine Optik und Akustik des Empfangens sein, die identisch mit einer Poetik und Erotik der Hingabe wäre: Wir schenken dem Buch unsere Augen. Wir schenken dem Buch unsere Ohren. Wir schenken ihm – unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Das könnte der Traum eines Buches sein: der einsamere Traum, der die Bücher nachts wachhält. Wenn wir das Wort Gott durch das Wort Buch an dieser Stelle einmal ersetzen dürften, würden wir die Sehnsucht des Buches bei Flannery O’Connor lesen können: Ich kenne dich nicht, Gott, weil ich im Weg stehe. Bitte hilf mir – mich beiseite zu schieben. Ich kenne dich nicht, Buch, weil ich im Weg stehe. Bitte hilf mir: mich beiseite zu schieben.
Wer es schrieb, bleibt ihm mitgegeben.
In den Zeitungen steht:
»Geo Barents« rettet 168 Geflüchtete im Mittelmeer.
In den Zeitungen stand:
24 000 Tote seit 2014 – Sea-Watch 5 in Hamburg getauft.
Wenn wir lesen – werden wir gelesen. Wenn wir lesen – liest dieses Buch uns weiter. Das: ist das zweite Versprechen; der gemeinsame Bund. Jede Hand beweist es. In unseren aufgeschlagenen, wie zu einem muslimischen Gebet geformten Händen, die bereits die Form eines Buches imitieren, antizipieren und imaginieren, in der entschlossenen Bereitschaft dieser Geste der Demut, die nicht zufällig an die Art erinnert, wie wir ein Geschenk aus Dankbarkeit geben, empfängt uns das Buch; hilflos, und verwundet, die unzähligen Trümmer eines Menschen, der durch die Fingernägel der Sekunden nachts zu ihm kam, damit es uns unseren Namen sagt. Wir: sind für jedes Buch der Fremde, dem es sein Zuhause öffnet, der unbekannte, der anonyme, der absolut Andere, den das Buch einlädt, weil wir gekommen waren, und kamen; weil wir vor ihm standen – wie aus dem Nichts. Wir – sind vor jedem Buch xenos, hostis und hôte; die, die das Buch anruft, die, die es aufruft, die, die es in sich hineingerufen hat; die das Buch aufnimmt, ohne eine Gegenseitigkeit zu verlangen; die Toten und die Wiedergänger, die vor ihm erschienen sind wie ein Gespenst, einsam und unterwegs, damit es uns Zuflucht gewährt, Schutz und Asyl. Einen Menschen, der vor uns steht, weist ein Buch nicht ab. Mit dieser biblischen Antwort ist auch das zweite Versprechen verwandt. Wenn ein Buch sich uns schenkt, versprechen wir dem Buch Geduld. Das: ist das erste Versprechen. Wenn aber wir uns einem Buch geschenkt haben, verspricht dieses Buch uns – ebenfalls Geduld. Das: ist das zweite Versprechen. Seine unsicheren Seiten geben es: Das Buch existiert nur für uns. Es spricht zu uns, in einer Sprache, die wir noch nie gehört haben: damit sie unsere ist; weil sie unsere sein wird. An dieser Sprache erkennt es uns in unserem innersten Wesen wieder. In dieser Sprache stehen wir vor ihm. In dieser Sprache – stehen wir von den Toten wieder auf. Das altgriechische xenos ist die Wurzel von xenia – der Gastfreundschaft. Die Idee des Buches, so, wie auch die Idee des Lesens, von der wir hier ausgingen, gibt es nur, weil sie bereits verkörpert ist: in der Realität der Bücher, die uns das Sprechen und Sterben beigebracht haben, zu leben, und weiterzuleben; die Bücher, deren Sätze zu unseren geworden sind, und deren Wörter unser Fleisch wurden. Das Buch kehrt das heilige Gesetz der Gastfreundschaft um – um es zu verwirklichen. Darin liegt das Geheimnis des Lesens: Wenn wir lesen, wenn wir gelesen werden, sind wir Gast und Gastgeber; Fremde unter Fremden, willkommen, und erkannt; die, die das Abendessen über den Tisch reichen, und die, denen der Teller über den Tisch gereicht wird. Ein Buch öffnet uns: wie ein Buch. Die Zeichen: zeichnen uns gegen. Der Akt der Poesie: kann nur gastfreundlich sein. Das ist das Rätsel der Gnade. Die konstitutive Adressiertheit der Sprache können wir als ihre sanfteste Absicht verstehen: Das Schenken der Augen, der Ohren, und der ungeteilten Aufmerksamkeit, gesehen und gehört, erkannt und anerkannt zu werden, ist eine Paraphrase der Liebe. Aber die Ästhetik und Ethik des Lesens, diese Poetik und Hermeneutik der Gastfreundschaft, ihre Optik, und Akustik formulieren auch ein drittes Versprechen, das noch eingehalten werden muss, damit die Poetik der Gastfreundschaft identisch mit ihrer Politik wird: jeden Menschen nach langer Flucht, jeden verlorenen Odysseus, der zu uns kommt und noch zu uns kommen wird, müssen wir nach dem Wesen jeder Sprache, und mit dem Wesen der Sprache, hier bei uns aufnehmen: mit Freundschaft, und Gastlichkeit. Nur das – wäre die Vollkommenheit des abrahamitischen Gesetzes. Das Gesetz der absoluten Gastfreundschaft gebietet, mit der rechtlich geregelten zu brechen. Damit auch hier, in diesen Ländern, und auf diesem Kontinent, ein fremder Mensch empfangen wird, so, wie Abraham Gott empfing. Jedes Buch – kehrt das Gesetz der Gastfreundschaft um. Vielleicht nennt aus diesem empfindsamsten Wissen heraus Celan das Gedicht auch eine Art Heimkehr. Aber diesen dritten Bund: müssen wir noch schließen. An ihm allein wird sich die Wahrheit des ersten und des zweiten Bundes, der Ernst des ersten und zweiten Versprechens entscheiden.
Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, und verneigte sich zur Erde.
Nachwort
Jede Handlung besitzt einen doppelten Sinn: einen naheliegenden, und einen entfernten. Dieser entfernte Sinn, den wir auch einen verborgenen nennen könnten, weil er so tief in der Handlung, in ihrer Alltäglichkeit und Gewohnheit liegt, dass er von ihr selbst verschüttet und verdeckt worden ist, ist Gegenstand verschiedener Wissenschaften: der Philosophie, der Theologie, der Sozial- und Kulturwissenschaften; der Psychoanalyse. Sie alle verbindet eine Anstrengung, dasselbe Anliegen: die verborgene Bedeutung verständlich zu machen; sie in unser Bewusstsein zu rufen. Der Essay In der entschlossenen Bereitschaft dieser Geste widmet sich dem impliziten Sinn des Lesens, der weder identisch mit der expliziten Aufnahme von Informationen noch mit dem Rätsel der ästhetischen Erfahrung poetischer Texte ist. Auch das Lesen als Kulturtechnik, nicht älter als die Erfindung des Feuersmachens oder des Tanzes, aber alt, und, durch verschiedene Politiken der Alphabetisierung, mittlerweile auch verbreitet genug, um als eine Menschheitserfahrung bezeichnet werden zu können, gehört zur kulturellen Identität vieler Menschen, die, im Bereich des Symbolischen, eine Bedeutung besitzt, der wir uns nicht bewusst sind. Der Essay versteht die Gastfreundschaft als den entfernten, den verborgenen, den impliziten Sinn des Lesens, als ein unerfülltes Versprechen, das wir noch einhalten müssen, wenn wir alle Konsequenzen aus dem Lesen, aus seiner Dramaturgie und Sehnsucht ziehen wollen. Uns ist, schreibt Walter Benjamin in seinen Thesen Über den Begriff der Geschichte, uns ist, wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat. Diese schwache messianische Kraft, die uns durch das Lesen mit- und aufgegeben wurde, als ein Gebot, als ein Gesetz, wird in dem Essay in Form und nach den Maßstäben einer Erkenntnistheorie der Poetik, die sich auf Paul Celan, Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas, Simone Weil, Annie Ernaux und Flannery O’Connor bezieht, als die Forderung nach der unbedingten Aufnahme des Fremden und der Fremden formuliert. Diesen Bund, den wir mit dem Lesen geschlossen haben, ohne uns darüber bewusst gewesen zu sein, müssen wir noch schließen, wenn wir Lesen nicht nur als Kulturtechnik, sondern auch als eine Kultur verstehen wollen. In ihr liegt nicht nur der Anspruch einer Vergangenheit, sondern auch jeder Zukunft; damit der naheliegende Sinn unser nächster wird; damit wir uns erinnern, was in unser Bewusstsein gerufen wurde; damit wir erkennen, wie auch wir von der Schrift erkannt worden sind.
